
11)
Reifrock
Ein
durch Reifen aus Holz, Draht oder Fischbein in einer bestimmten
Form gehaltener Frauenrock, meist Unterrock (Halbrock).
Um die Mode zu signifizieren, wird auch der darüber
liegende, unversteifte obere Rock oft als Reifrock bezeichnet.
Bereits
um 1470 wurde in Spanien der Kleiderrock außen sichtbar
mit etwa 6 Gertenringen zu einer Glocken- bis Kegelform
abgesteift. Dieser Rock wurde in Venedig verboten, jedoch
in Frankreich unter Franz I., also nach 1515, sowie in
England vor Mitte des 16. Jahrhunderts angenommen. Von
span. Verdugo „biegsame Gerte, Rute" wurde die erste Bezeichnung
für „Reifrock" abgeleitet, Verdugado, auch Verdugada
(span., „etwas aus Reifen Gemachtes, Reifrock"), frz.
Zu Vertugale, Vertugade oder Vertugadin, engl. Zu Verdingale,
Farthingale.
Um
Mitte des 16. Jahrhunderts wurde in Spanien der mit Reifen
ausgestattete Rock zu einem unteren Rock und verschmolz
mit der Basquina. Zusätzlich wurde der Oberrock mit
Wachstuch, Filz- oder Rosshaarauflagen abgesteift. Diese
Stützen dienten auch dazu, die Last der Roben aus
schwerem Brokat, Damast oder Samt tragen zu helfen. Der
Verdugado nahm die für die 2. Hälfte des 16.
Jahrhunderts charakteristische Kegelform an, über
die sich der aus keilförmigen Teilen zusammengesetzte
Rock des Manteaus oder Kleides faltenlos spannte. Diese
berührten genau den Boden, so dass die Füße
stets bedeckt waren.
Außerhalb Spaniens, besonders in Italien, war der
Oberrock jedoch seitlich in Falten an das Oberteil angesetzt.
In Italien wurde die extreme spanische Form des Reifrocks
nicht angenommen. Nach 1580 öffnete sich vorn der
obere Rock und gab in einer Dreiecksform den vorn mit
Oberstoff versehenen unteren Rock, frz. „Jupe" genannt,
oder die Basquina frei.In
Frankreich und England entwickelte sich der Reifrock zunächst
zu einer Glockenform, nach 1575/80 zu einer Tonnenform,
Vertugade en tambour (frz., „Trommelreifrock") genannt,
bei dem der Rock in der Taille fast horizontal abstand,
was oft zusätzlich durch einen kurzen Volant betont
wurde. In Frankreich schleppte das Kleid darüber
am Boden, während es in England gerade knöchellang
war. In nordischen Ländern hielt sich die Vertugade
en tambour bis um 1630. In der spanischen Hofmode gab
es den steifen, kegelförmigen Reifrock bis nach 1630.
Um 1650 nahm er eine ovale, vorn und hinten abgeflachte
Form an, die in Spanien Guarda infantes, in Frankreich
Garde-infant, Sacristain oder Tontillo genannt wurde.
Dieser Reifrock hielt sich in der höfischen Zeremonialkleidung
bis ins 18. Jh.. Ansonsten wurde bereits um 1600 der Reifrock
zugunsten eines runden Hüftpolsters aufgegeben. Zur
Robe a la fontagne (Kleid) kam um 1700 in England ein
Reifrock auf, der aber in Frankreich nur kurze Zeit in
Mode war.
Der Reifrock erschien erneut Anfang des 18. Jahrhunderts. Er bestand aus 7-8 mit Wachstuch verbundenen Rohrreifen, die beide zusammen beim Gehen ein unverkennbares Knarren verursachten, weshalb er ugs. Frz. Criarde (von frz. Criard „kreischend, knarrend"), dt. Kreischerin genannt wurde. 1718 nahm er die Form des Panier (frz., „Korb", ugs. Hühnerkorb) an, eine Bezeichnung, unter der sich der Reifrock, in welcher Form auch immer, in Frankreich im ganzen 18. Jahrhunderts hielt; in England Hoop petticoat genannt. Die Reifen bestanden nun aus Fischbein und waren mit Stoff verbunden; bis etwa 1725 in noch mäßig umfangreicher Kegelform, danach in Kuppelform, deren Höhepunkt bis etwa 1750 war. Der Rock des Manteau war vorn geöffnet und ließ die Jupe sichtbar werden. Bereits ab etwa 1745 - 86 wurde für die Hofgala der Parnier a coudes (frz., „Reifrock für die Ellbogen"), ein vorn und hinten abgeflachter und seitlich über den Hüften stark aufgetriebener Reifrock getragen. Um 1760 - 75 hatte dieser eine etwas dezentere Form. Im Negligé und in der bürgerlichen Kleidung dagegen kamen nach Mitte des 18. Jahrhunderts kleinere und leichtere Reifröcke auf: um 1750 der sog. Halbe Panier, frz. Demi-panier, Panier double oder Janseniste, im Dt. ugs. Springrock oder Hänschen genannt, der aus Hüftculs bestand (zwei mit Reifen verbundenen Reifengestellen, Cul de Paris), die bis zu den Knien reichten. Diesen Reifrock ersetzten um 1770 die noch leichteren considerations. Der Oberrock wurde nun fußfrei getragen. In den 1780er Jahren verdrängte den Reifrock mehr und mehr der Cul de Paris. Im 18. Jh. Sicherten Kleiderordnungen den Reifrock der Oberschicht, doch setzten sich Bauern. Und Dienstmädchen mehr denn je darüber hinweg.
1856 - 68/69 war der Reifrock erneut in Form der künstlichen Krinoline in Mode. Er verkleinerte sich danach zur Turnüre, deren Vorbild der Cul de Paris vom Ende des 18. Jahrhunderts und für V. Westwoods Mini Crini war.
12)
Sarong
Der
Sarong ist ein um die Hüften gewickeltes Tuch der
Malaien (Wickelrock); heute Vorbild für Strandmode.
Fälschlicherweise auch Bezeichnung für den Rock
in Mesopotamien.
13)
Unterrock/ Unterkleid
Ein
unter dem Kleid, aber über dem Hemd getragenes, meist
ärmelloses Hemdgewand (Unterkleid) oder ein separater
Rock (Unterrock), beide stets etwa in der Länge des
Oberkleidrocks. In
der griechischen Antike wurde im Prinzip kein Untergewand
getragen. Die Frau legte unter dem Peplos zuweilen noch
einen Chiton an. In der römischen Antike zogen beide
Geschlechter höchstens als Kälteschutz zwei
oder mehrere untere Tuniken an.
Im Mittelalter war bei beiden Geschlechtern höheren Standes die Niderwat, auch Niderkleit und afrz. Chainse genannt, verbreitet. In der 2. Hälfte des 14. Jahrhunderts wurden mit der Verkürzung des Männerobergewandes Unterrock und Unterkleid zu einem reinen Frauenbekleidungsstück. Vom 16. Bis zur 1. Hälfte des 18. Jh.s hieß der Unterrock im Dt. Kotillon. Ab dem 16. Jh. Wurden meist mehrere Unterröcke zur Stützung des weiten Kleidrocks unentbehrlich; eine Zugschnur in der Taille hielt sie. Der Unterrock galt als Standeszeichen; um so vornehmer war das Tragen mehrerer Unterröcke. Neben dem unter dem hochgerafften Kleidrock sichtbar werdenden unteren Rock aus kostbarem Stoff wurde der Unterrock aus Leinen, Wolle und Baumwollgemisch in Weiß oder Rot getragen. In der 2. Hälfte des 16. Bis Anfang des 17. Jh.s verminderte der Reifrock die Zahl der Unterröcke. Im 17. Jh. Wurden im Sommer bis zu 8, im Winter bis zu 12 Unterröcke getragen. Der oberste, oftmals mit Schleppe ausgestattete Unterrock hieß „la modeste" (frz., „die Sittsame"), der mittlere „la friponne" (frz., „die Schelmische"), der unterste „la secrête" (frz., „die Verschwiegene"). Rote, auch reich mit Spitzen besetzte Unterröcke waren besonders modisch. Zuweilen wurde der Unterrock auch an das „Leibstück" genestelt. Im Rokoko bezeichnete man den unter dem Reifrock getragenen Unterrock als Jupon, im Dt. ugs. Als Appetitröckl (da er beim Hochheben des Reifrocks sichtbar wurde); er war aus Seide und um den Saum bestickt oder bordiert. Der unterste Unterrock, der Sabenque (span.), dagegen war aus Leinen. Der über dem Reifrock liegende, vorn sichtbare Rock war die Jupe, der jedoch nicht als eigentlicher Unterrock gilt.
Im Directoire (1795 - 99) und Empire (1800 bis 1815/20) wurde unter der Chemise neben einem Trikot ein meist zartfarbener Unterrock im Schnitt des Obergewandes getragen. Nach 1816 wurden die Unterröcke etwas abgesteift und allmählich ihre Zahl erhöht. Ende der 20er Jahre begann man, den Unterrock an ein Leibchen zu nähen, und erhielt so ein Unterkleid; es war hinten zu schließen und bekam, wie das Kleid, die Schneppentaille. Der Unterrock selbst war zum Saum hin ausgestellt und mit waagerecht aufgelegten Schnüren abgesteppt, ab 1827 mit Fischbein und ab 1840 mit Rosshaar um den Saum abgesteift (Krinoline). Der oberste Unterrock, meist aus weißer Baumwolle, war mit Durchbrucharbeit (Spitze) verziert. 1842 wurde die „Crinolisation", 1856 die künstliche Krinoline erfunden, unter der, ebenso wie später unter der Turnüre, ein einfacher Baumwollunterrock getragen wurde. An die Stelle eines Unterkleides konnten auch Unterrock und Kamisol treten. 1857 tauchten im Pariser Genre canaille wieder rote Unterröcke auf, die noch schockierend wirkten, etwa ab 1866 aber allgemein Verbreitung fanden. Unter der Turnüre und dem Cul de Paris konnte auch der Unterrock über dem Gesäß zusammengerafft werden, oder es gab halbe Unterröcke. Während der engen Mode (1875 - 81) gab es ein separates Schleppunterkleid, das in den Kleidrock geknöpft wurde. Etwa 1890 - 1907 war der Unterrock als Bahnen- oder Glockenrock geschnitten und um den Saum mit Rosshaar abgesteift. 1897 kam eine Unterrockhose, 1898 eine Korsett-Unterrockhose auf (Combinaison). Nach 1898 war das Unterkleid dekolletiert, der Unterrock hatte eine Schleppe mit Balayeusen, die das gewünschte Frou-Frou erzeugten. Verarbeitet hat man Seiden, Tafte, zunehmend Kunstseide und im Winter Flanell.
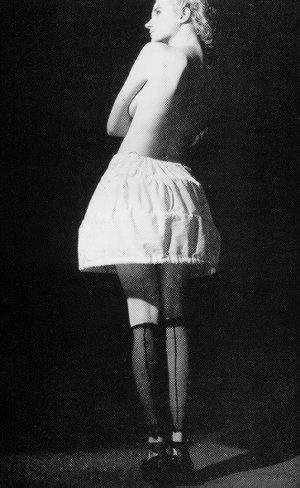
1)
Bahnenrock
Glockenrock,
der 1898 durch einzelne, konisch geschnittene Bahnen entstanden
und dadurch um die Hüften anliegend und um den noch
knöchellangen Saum bequem weit war.
2)
Ballonrock/ Ballon-Look
1957
von H. de Givenchy kreierte Modelinie mit weitem Petticoatrock,
der um den Saum durch eine hohe, enge Passe stark eingehalten
war, wodurch eine ballonartige Silhouette des Rockes entstand.
Diese extreme Linie fand kurzzeitig (etwa bis 1958) bei
Cocktailkleidern Anklang.
3)
Faltenrock
Rock,
der im Bund regelmäßig genähte oder gebügelte
Falten aufweist, oder ein glatter Rock mit einem breiten
Faltensaum. Bei den Falten handelt es sich meist um einseitige
Falten, Keller-, Quetsch- oder Plisseefalten. Der Faltenrock
kam bei der Turnüre um 1870 in Mode.
4)
Glockenrock
Der
Glockenrock, bis zum 2. Weltkrieg auch Bahnenrock genannt,
ist ein um die Hüften anliegender und zum Saum hin
glockig ausschwingender Frauenrock, dessen Schnitt - der
Rock besteht aus einem Kreis oder Kreissegment - erst
1898 erfunden wurde. Seit dem 2. Weltkrieg wird der kreisrund
zugeschnittene Tellerrock, auch Glockenrock (Vollglocke)
genannt, im Unterschied zum eigentlichen Glockenrock,
nun als Halb glocke bezeichnet.
5)
Jupe
Im
letzten Viertel des 17. und im 18. Jh. Allgemein für
den unter dem vorn offenen Manteau zur Geltung kommenden
Rock der Frau. Der so sichtbare Teil der Jupe konnte sowohl
aus anderem wie auch aus dem gleichen Stoff wie der Manteau
sei, jedoch war der unsichtbare Teil aus anspruchslosem,
ungemustertem Stoff, z.B. Leinen oder einfache Seide.
In der Taille wurde die Jupe locker angereiht und hinten
mit einem Band zusammengebunden. Im Spätbarock war
sie mit breiten Borten, Spitzenvolants, besonders aus
eben in Mode gekommenen schwarzen oder plissierten Spitzen
„a la psyche", Stickereiborten, Quastenkordeln, Pretintailles,
Pistaigne, Froschmäulchen oder Falbalas verziert.
Die Jupe trainante hatte, wie der name sagt, eine Schleppe.
Im Rokoko passte sich die Jupe der Form des Reifrocks
an. In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts wies
sie noch eine leichte Fältelung in der Taille auf
und war höchstens mit ein oder zwei Volantreihen,
Rüschen oder Rosetten verziert. In der zweiten Hälfte
des Jahrhunderts wurde sie zur Robe a la française
reich mit Girlanden, Quasten und Fransen geschmückt.
Zur robe a la polonaise war die Jupe kaum knöchellang.
Im Schweizerdt. wird der Rock der Frau noch heute Jupe
genannt.
6)
Kaminrock
Ein
langer Abendrock der Frau, meist aus Wollstoff oder Samt,
als elegante Hauskleidung besonders in den 1960er Jahren
beliebt.
7)
Kilt
Der
Kilt ist ein um die Hüften gewickelter, etwa knielanger
Rock, der seitlich mit einem Lederriemen und einer Silbernadel
zusammengehalten wird. Auf der Rückseite hat er regelmäßige,
einseitige Liegefalten. Der Kilt besteht seit der Eisenzeit
aus einem in den Stammesfarben (Clanfarben) karierten
Wollstoff. Er wird eigentlich ohne Unterkleidung (da ursprünglich
ein Schurz) getragen. Den Kilt kannte man auch in der
Bretagne. Er erhielt sich als Teil der Nationaltracht,
dazu Parade- und Ausgehuniform der Schotten; heute auch
modischer Frauenrock.
8)
Miederrock
Rock
der Dame mit angeschnittenen, bis über die Taille
hinaufgehendem Bund (Taillenmieder), insbesondere in den
1950er modern.
9)
Mini (-Mode)
Jugendliche
Mode, etwa 1963/1964 - 73 (mit Unterbrechung 1970/71:
Midi), bei der der Rock höchstens die Oberschenkel
bedeckte oder noch kürzer war, Höhepunkt 1967
- 69. 1964/65 führte A. Courreges die Mini-Länge
auch in der Haute Couture ein.
10)
Petticoat
Der
Petticoat /engl. „kleiner Rock"), in Deutschland auch
Wipprock genannt, ist ein weiter, steifer Unterrock aus
Perlon oder gestärkter Baumwolle, oft mit Spitzenvolants,
der den weiten, glockigen, jugendlichen, anfangs fast
wadenlangen, später nur knielangen Rock, den Petticoatrock
der 1950er und beginnenden 60er Jahre, unterstützte.
Zuweilen war der Petticoat auch an das Korsett genäht.
1982 wurde der Petticoat in Minilänge, 1983 wadenlang
von Mädchen wiederentdeckt.

Das im 20. Jh. Bevorzugte Unterkleid passte sich weitgehend dem Schnitt des Oberkleides an. In den 1920er Jahren behauptete sich neben dem Unterkleid in Hängerform mit waagerechtem Ausschnitt und dünnen Trägern die Unterrockhose.
1947 brachte der New Look den Unterrock wieder, der in den 50er und Anfang der 60er Jahre zu dem bei Mädchen sehr beliebten Petticoat aus sehr gestärkter Baumwolle, Nylon oder Tüll wurde. Zuweilen war dr Petticoat an das Korsett genäht. Nach 1964/65 nahm die Verbreitung von Unterkleid und Unterrock stark zugunsten einer durchgehenden Fütterung des Kleides ab. Außerdem wurde von nun an weniger Anstoß an durchsichtiger Oberkleidung genommen als früher.
14)
Wickelrock
urspr.
Ein ungenähter Halbrock, dessen Kanten stark übereinander
treten und der durch Umrollen des oberen Randes oder durch
eine seitliche Spange, heute auch durch einen oder mehrere
Knöpfe, gehalten wird; Kaunakes der Frühdynastischen
Periode Mesopotamiens (3000 - 2700 v. Chr.). Der Kilt
der schottischen Nationaltracht ist bereits ein z.T. genähter,
weil u.a. mit einem Taillenbund versehener Wickelrock.
Auf Figur genäht sind auch die Wickelröcke der
Frau um 1920 - 14, 1924, Anfang der 1950er Jahre und um
1970.